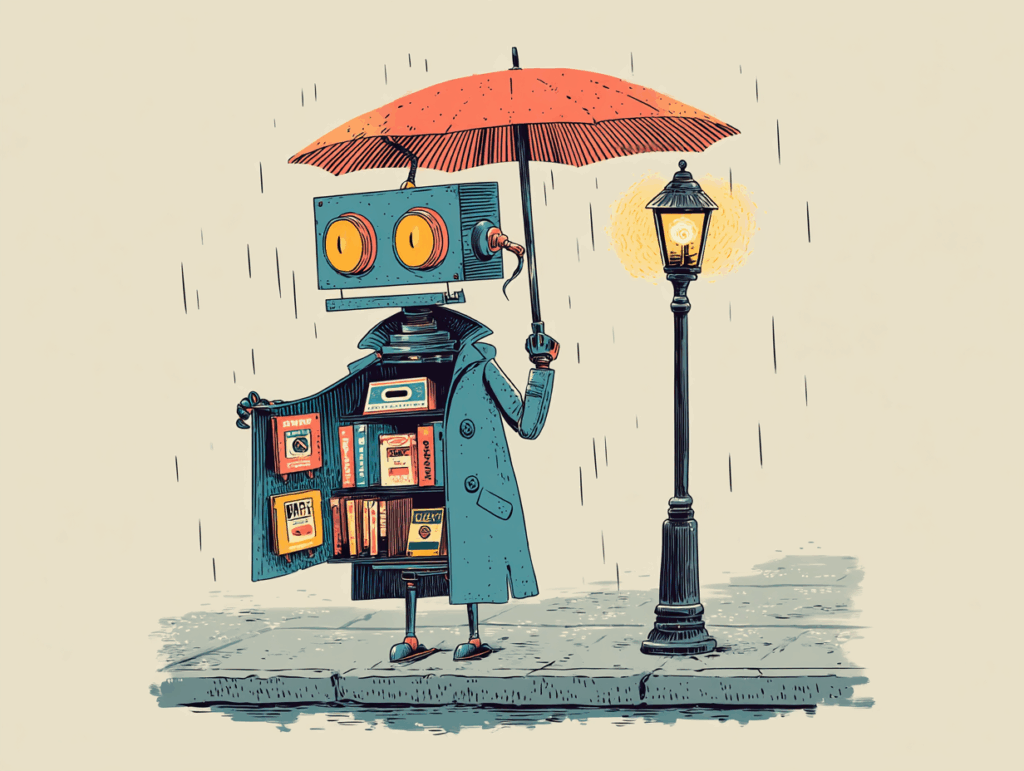Erinnern Sie sich an Napster? Sie war die erste grosse illegale Online-Musiktauschbörse. Die Musikindustrie gewann damals jeden Prozess – und verlor trotzdem den Kampf gegen das Internet. Heute wiederholt sich die Geschichte, nur mit Büchern, Artikeln, Bildern und Songtexten statt MP3s. Innerhalb von acht Tagen gab es vier entscheidende Urheberrechts-Entscheidungen gegen grosse KI-Unternehmen. Das ist kein Zufall. Es ist der Beginn einer juristischen Welle.
Deutschland prescht vor: Gericht erklärt ChatGPT zum Urheberrechtsverletzer
Am 11. November fällte ein Münchner Gericht das erste grosse europäische Urteil:
ChatGPT verletzt deutsches Urheberrecht, weil das Modell geschützte Songtexte reproduziert. Klägerin war die GEMA, die mehr als 100’000 Komponisten vertritt.
Das Gericht stellte fest, dass GPT-4 und GPT-4o «reproduzierbare» Textpassagen von neun bekannten Songs ausgeben – darunter «Atemlos» und Werke von Rolf Zuckowski. OpenAIs Argument, das Modell speichere keine Werke, sondern «lerne Muster», wies das Gericht zurück.
Die Signalwirkung ist enorm. GEMA-Chef Tobias Holzmüller sprach von einem Präzedenzfall:
«Auch Betreiber von KI-Tools müssen sich an das Urheberrecht halten.»
Wenn Lernen als Kopieren gewertet wird, wären theoretisch alle KI-Modelle illegal, die auf geschütztem Material trainiert wurden.
Meta ertappt: 81,7 Terabyte Bücher aus Schattenbibliotheken
Noch explosiver sind die Enthüllungen bei Meta. Gerichtsdokumente belegen, dass Meta 81,7 TB piratisierte Bücher aus LibGen, Z-Library und Anna’s Archive für das Training seiner Llama-Modelle herunterlud.
Besonders brisant:
- Mark Zuckerberg genehmigte persönlich die Nutzung der Daten, obwohl intern ausdrücklich gewarnt wurde.
- Mitarbeitende scherzten über Torrent-Downloads auf Firmenlaptops («Fühlt sich nicht richtig an 😂»).
- Andere mahnten, der Einsatz piratisierter Werke liege «jenseits unserer ethischen Schwelle».
- Meta lud die Daten später im Stealth-Modus ausserhalb der offiziellen Infrastruktur herunter, um die Aktivität zu verschleiern.
Das wirkt nicht wie ein Weltkonzern – sondern wie eine digitale Version der Hehlerei.
Verlage gegen Cohere: Systematische Urheberrechtsverletzung
Vierzehn grosse Verlage – darunter Condé Nast, Forbes und der Toronto Star – verklagen das kanadische KI-Unternehmen Cohere. Der Vorwurf: massive, systematische Nutzung von mindestens 4’000 Artikeln ohne Erlaubnis.
Ein New Yorker Gericht lehnte Coheres Antrag auf Abweisung vollständig ab. Besonders heikel: Cohere soll nicht nur Inhalte übernommen, sondern sogar erfundene Artikel unter den Namen der Verlage veröffentlicht haben.
Getty vs. Stability AI: Ein Urteil mit gemischter Wirkung
Im Verfahren Getty Images vs. Stability AI entschied das britische Gericht zweigeteilt:
- Urheberrechtsansprüche: abgewiesen
- Markenrechtsverletzungen: bestätigt, da Stable Diffusion Getty-Wasserzeichen reproduzierte
Entscheidend ist die juristische Klarstellung:
Das Training eines KI-Modells mit geschützten Werken ist keine sekundäre Urheberrechtsverletzung, solange das Modell diese Werke nicht speichert oder reproduziert.
Allerdings gilt das nur, weil das Training ausserhalb Grossbritanniens stattfand.
Für die Branche ist das ein halber Sieg – mit vielen Fragezeichen.
Die Grundfrage: Wie soll KI legal trainiert werden?
Die Parallelen zu Napster sind offensichtlich.
Damals behaupteten File-Sharing-Dienste, sie stellten nur Technologie bereit.
Heute sagen KI-Unternehmen, ihre Modelle «lernen», aber kopieren nicht.
Der Konflikt ist derselbe:
Technologischer Fortschritt trifft auf Urheberrechtssysteme aus dem letzten Jahrhundert.
Die möglichen Wege:
Option 1: Milliarden-Lizenzen
OpenAI geht diesen Weg bereits mit einigen Verlagen.
Problem: Bei Millionen Werken wird das unerschwinglich.
Option 2: Fair-Use-Neuregelung
Die USA bewegen sich dahin.
Europa bleibt skeptisch und klammert sich an bestehende Regeln.
Option 3: Open Source wird zum Kollateralschaden
Wenn jedes Modell mit geschütztem Trainingsmaterial illegal ist, trifft es vor allem Open-Source-Projekte.
Big Tech kann sich Lizenzen leisten – kleine Forschende nicht.
Was bedeutet das für die Schweiz?
Die Schweiz steht zwischen drei Modellen:
- USA: tendenziell Fair Use
- EU: striktes Urheberrecht
- Schweiz: traditionell liberal, aber ohne klare KI-Regeln
Für Schweizer Kreative sind die neuen Urteile ein Schutzschild.
Für Schweizer KI-Unternehmen dagegen ein Risiko: Zu strenge Vorgaben könnten Forschung und Entwicklung erheblich verlangsamen.
Die Schweiz braucht einen Mittelweg – sonst verliert sie im globalen KI-Wettlauf.
Die Geschichte wiederholt sich – mit neuen Spielern
Der Konflikt erinnert stark an die Napster-Ära. Die Musikindustrie gewann zwar die Klagen, aber verlor die kulturelle Kontrolle. Heute stehen KI-Firmen an derselben Stelle wie damals die MP3-Sharing-Plattformen.
Richter Chhabria sprach in einem Verfahren gegen Meta bereits von «seriellen Urheberrechtsverletzern» und forderte Autoren auf, bessere Klagen einzureichen. Die Lawine rollt gerade erst an.
Die Ironie könnte grösser kaum sein:
Während KI-Unternehmen Milliardenbewertungen erreichen, basieren viele ihrer Modelle auf Material, das sie ohne Erlaubnis verwendet haben.
Big Tech wirkt in diesen Fällen weniger wie visionäre Innovatoren –
sondern eher wie Teenager auf Pirate Bay.
Nur mit besseren Anwälten.